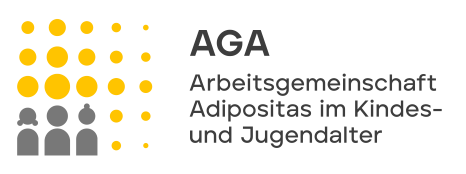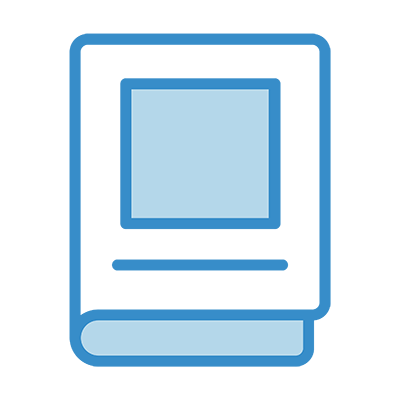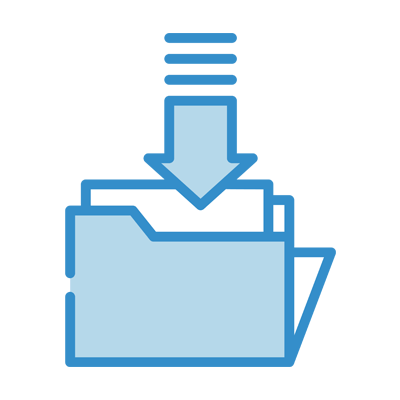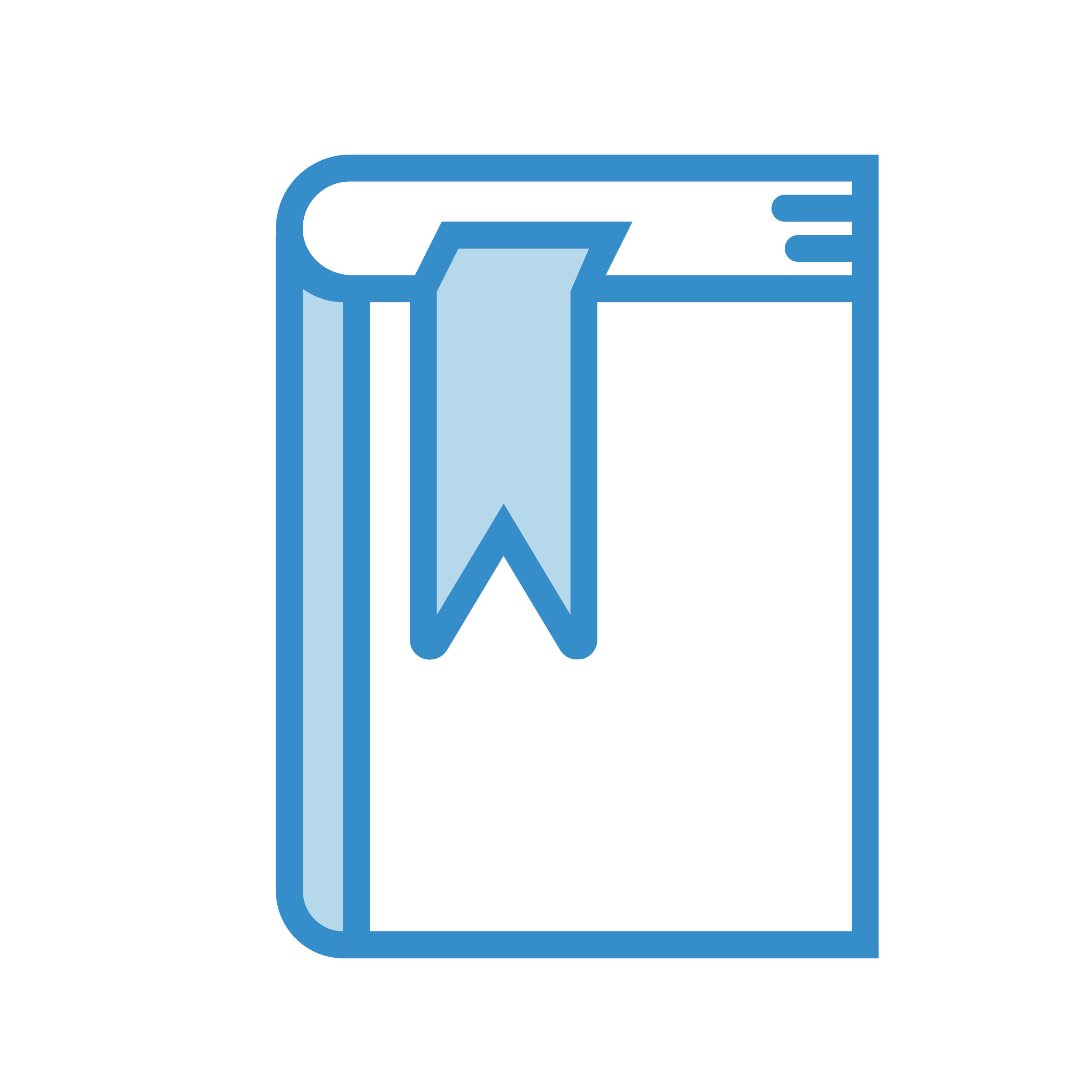Herzlich Willkommen auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG) e.V!
Als Arbeitsgruppe der DAG e.V. ist die Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter (AGA) (www.a-g-a.de) für die Kinder- und Jugendlichen zuständig. Der gemeinnützige Verein hat sich vorrangig zum Ziel gesetzt, Forschung, wissenschaftliche Diskussion, Weiterbildung und wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich Adipositas zu fördern sowie Konzepte und Leitlinien zu Prävention, Diagnose und Therapie der Adipositas zu entwickeln. Fachorgane der DAG sind die Zeitschriften „Adipositas“ (Thieme Verlag) und „Obesity Facts“ (Karger Verlag). Die DAG/AGA ist Mitglied der World Obesity Federation (www.worldobesity.org), der European Association for the Study of Obesity (www.easo.org) sowie Mitgliedsgesellschaft der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) und der Deutschen Allianz Nichtübertragbarer Krankheiten (DANK) (www.dank-allianz.de).
Die AGA ist gut vernetzt: Sie ist korporatives Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) und Kooperationspartner der European Childhood Obesity Group (ECOG) sowie der Childhood Obesity Task Force (IOTF). Weiterhin bestehen enge Kooperationen mit der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und -diabetologie (DGKED) sowie der Konsensusgruppe Adipositasschulung für Kinder und Jugendliche e.V. (KgAS).

Erfahren Sie mehr über unser Ziel
Was wir tun
Als Arbeitsgruppe der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG) e.V. initiieren und fördern wir klinische und wissenschaftliche Projekte auf dem Gebiet der Adipositas im Kindes- und Jugendalter, insbesondere zu den Themen Ursachenforschung, Diagnostik, Prävention und Therapie.

Lernen Sie unseren Vorstand und den Beirat kennen
Unser Vorstand
Der Vorstand besteht aus 7 Mitgliedern (1 Sprecher/-in und 6 weitere Mitglieder). Der Sprecher/Die Sprecherin und ein weiteres Mitglied müssen dem Fachgebiet Padiätrie angehören, je ein weiteres Mitglied dem Fachgebiet Psychologie, Ernährung und Sport. Die beiden anderen Mitglieder können einem beliebigen Fachgebiet angehören (freie Mitglieder).
Der Vorstand wird von der AGA-Mitgliederversammlung in geheimer schriftlicher Wahl gewählt.

Lesen Sie mehr über die Daten, Fakten & Forschungen
Über Adipositas
Adipositas ist eine chronische Krankheit, die auch in Deutschland ein zentrales und häufig vorkommendes Gesundheitsproblem darstellt. Adipositas kann zu schwerwiegenden Begleit- und Folgeerkrankungen führen, ist häufig mit einer Einschränkung der Lebensqualität und Verkürzung der Lebenszeit verbunden. Adipositas belastet die Volkswirtschaft erheblich.

Die Leitlinien der AGA
Die AGA hat derzeit mehrere Leitlinien zur Therapie und Prävention der Adipositas herausgegeben: